
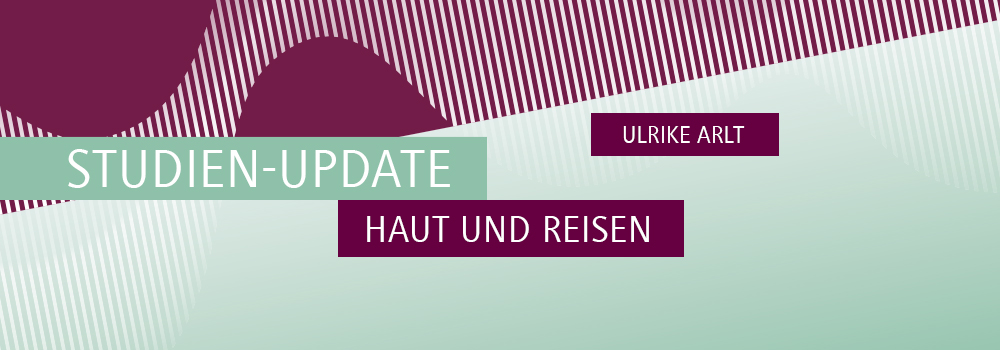
Mpox: Langzeitdaten zur Klade-IIb-Variante +++ Chikungunya-Impfstoff wirksam trotz Alphavirus-Vorimmunisierung +++ Tinea-Infektionen: Antifungale Resistenzen nehmen zu +++ Desinfektion der Hände auf Reisen +++ App-Surveillance
Mpox: Langzeitdaten zur Klade-IIb-Variante
Die europäische MOSAIC-Kohortenstudie liefert erstmals standardisierte Daten zum klinischen Verlauf der Mpox-Erkrankung durch das Klade-IIb-Virus. In 6 Ländern wurden 575 Patienten und Patientinnen mit aktiver Erkrankung eingeschlossen, von denen 57 eine systemische antivirale Therapie (meist Tecovirimat) erhielten. Die mediane Zeit bis zur Diagnosestellung betrug 5 Tage nach Symptombeginn. Bei 90 % der unbehandelten Personen war eine ambulante Versorgung ausreichend. Hautläsionen traten bei 88 % auf, bevorzugt im perianalen oder genitalen Bereich (74 %).
An Tag 14 nach Erstnachweis von MPXV-DNA mittels PCR waren 39 % der Läsionen abgeheilt, an Tag 28 68 %. Virologisch zeigte sich die längste Persistenz kultivierbaren Virusmaterials in Hautläsionen (bis zu 52 Tage); in Blutproben war das Virus meist nach 10 Tagen nicht mehr kultivierbar. Systemisch behandelte Patientinnen und Patienten wiesen meist schwerere Verläufe mit höherer Anzahl an Läsionen auf; bei ihnen verlängerte sich die Viruspersistenz auf bis zu 60 Tage. Schwere Komplikationen waren selten, Todesfälle traten nicht auf.
Fazit: Die Studie liefert erstmals standardisierte Verlaufsdaten zu Klade-IIb-Mpox in Europa. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für das Management künftiger Ausbrüche.
Pesonel E et al., Clin Infect Dis 2025; 80: 1060–73
Chikungunya-Impfstoff wirksam trotz Alphavirus-Vorimmunisierung
Eine randomisierte, kontrollierte Studie aus den USA untersuchte die Immunogenität und Sicherheit eines Aluminiumhydroxid-adjuvantierten Chikungunya-Virus-VLP-Impfstoffs (CHIKV VLP) bei Personen mit oder ohne Vorimpfung gegen andere Alphaviren. In einer offenen, randomisierten Phase-II-Studie erhielten 60 Erwachsene (davon 30 mit früherer VEEV-Impfung) eine einmalige 40-μg-Dosis des CHIKV-VLP-Impfstoffs. Beide Gruppen erreichten an Tag 22 eine 100%ige Serokonversionsrate (≥ 4-facher Anstieg der neutralisierenden Antikörper gegen CHIKV). Bereits an Tag 8 zeigte sich bei den Vorimmunisierten eine signifikant schnellere Serokonversion (93,3 % vs. 66,7 %; p = 0,021). Die Immunantwort blieb bis Tag 182 in beiden Gruppen weitgehend erhalten. Es wurden keine Hinweise auf immunologische Interferenzen mit früheren VEEV-Impfungen beobachtet. Die Verträglichkeit des Impfstoffs war gut. Es traten keine impfstoffbedingten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse auf.
Fazit: Der CHIKV-VLP-Impfstoff induziert eine robuste und schnelle Immunantwort, auch bei Personen mit vorheriger Alphavirus-Immunisierung.
Hamer MJ et al., Lancet Microbe 2025; 6: 101000
Tinea-Infektionen: Antifungale Resistenzen nehmen zu
Trichophyton indotineae gewinnt als Ursache schwer behandelbarer Tinea-Infektionen weltweit an Bedeutung. Ursprünglich in Südasien verbreitet, tritt er zunehmend auch außerhalb des Subkontinents auf – meist reiseassoziiert, zunehmend aber durch lokale Transmission. Die Erreger zeigen häufig eine reduzierte Ansprechbarkeit auf Terbinafin, bedingt durch Mutationen im Squalene-Epoxidase-Gen (v. a. Leu393Phe, Phe397Leu). Itraconazol in höherer Dosierung (≥ 200 mg/Tag) und längerer Therapiedauer gilt derzeit als wirksame Alternative. Fluconazol und Griseofulvin sind meist ineffektiv. Bei begrenzter Ausdehnung können topische Non-Allylamin-Antimykotika – mono oder kombiniert – eingesetzt werden. Kommt es nach klinischer Abheilung zu Rückfällen, wird erneut Itraconazol empfohlen. Das Autorenteam der Literaturrecherche von Mai 2024 hebt 4 Fallberichte hervor, die bei Therapieversagen beider Substanzen gute Ansprechraten auf off-label eingesetzte Triazole wie Voriconazol oder Posaconazol zeigten.
Fazit: Die Entwicklung neuer molekularer Diagnostikverfahren und konsequentes antifungales Stewardship sind dringend erforderlich.
Gupta AK et al., Expert Rev Anti Infect Ther 2024; 22: 739–51
Desinfektion der Hände auf Reisen
Multiresistente gramnegative Erreger (MDRO) breiten sich global aus – internationale Reisen gelten als wesentlicher Risikofaktor. Eine Proof-of-Concept-Studie untersuchte bei 214 Reiserückkehrenden den Zusammenhang zwischen Desinfektionsverhalten und MDRO-Trägerschaft: 7,5 % waren post-travel kolonisiert – meist mit 3-MRGN-Escherichia-coli, die Präkolonisation lag bei 2,8 %. Alle post-travel-Fälle betrafen Reisen in Regionen mit erhöhtem MDRO-Risiko (Score 2–4), v. a. nach Süd- und Südostasien. Obwohl 81 % der Reisenden regelmäßig Desinfektionsmittel nutzten, ließ sich kein protektiver Effekt gegenüber MDRO-Kolonisation nachweisen. Nur 22 % verwendeten VAH-gelistete Präparate; über 40 % griffen zu OTC-Produkten unbekannter Zusammensetzung.
Fazit: Die Autorengruppe fordert eine stärkere Einbindung des Themas in die reisemedizinische Beratung. Ein eigens entwickelter Risikoscore zur geografisch differenzierten MDRO-Risikoeinschätzung – analog zur etablierten Malariakartierung – könnte helfen, gezielte Hygieneempfehlungen abzugeben.
Kaspers T et al., Travel Med Infect Dis 2025; 65: 102837
App-Surveillance
Eine multizentrische Studie erfasste bei 609 Reisenden aus Europa in Echtzeit reisemedizinische Symptome via App. Das kostenlose Tool ITIT (Infection Tracking in Travellers) ist in 14 Sprachen verfügbar. Von 470 dokumentierten Reisen waren 35 % von Beschwerden begleitet. Die häufigsten: gastrointestinal (19 %), respiratorisch (17 %) und allgemein (16 %). Dermatologische Beschwerden traten bei 7 % auf. Mit 53 Fällen pro 1 000 Tagesbefragungen war Diarrhö das häufigste Einzelsymptom – bei Asienreisenden sogar 90/1 000. Respiratorische Beschwerden dominierten in Europa, dermatologische in warmen Regionen. Juckende Insektenstiche (17/1 000), Exantheme (10/1 000) und Sonnenbrand (8/1 000) waren am häufigsten, v. a. bei Asienreisenden. Reisedauer, hohe Temperaturen und Sommerreisen erhöhten das dermatologische Risiko signifikant.
Fazit: Die ITIT-App verknüpft Symptome mit Geodaten und Wetterparametern und bietet eine neuartige Grundlage für Surveillance und Prävention. Für gesundheitliche Reiserisiken könnten so künftig differenzierte Risikoprofile erstellt werden.
Lovey T et al., BMJ Open 2024; 14: e083065