
Insbesondere bei Reisen in tropische Gebiete treten durch den Kontakt mit kontaminiertem Wasser unterschiedliche Dermatosen auf – ob in Salz- oder Süßwasser. Praxisrelevante Hinweise zu Diagnostik, Differenzialdiagnosen und Therapie dieser aquatisch erworbenen Hauterkrankungen.
Wasser gilt gemeinhin als Symbol der Reinheit – medizinisch betrachtet jedoch birgt es nicht selten das Risiko für Infektionen und immunologische Reaktionen, insbesondere an der Haut. Und so werden eine Reihe von Erkrankungen, die entweder durch pathogene Mikroorganismen oder physikalisch-mechanische Einwirkungen im Wasser hervorgerufen werden, unter dem Begriff „aquatisch erworbene Dermatosen“ zusammengefasst. Ein Teil von ihnen nimmt global zu – auch in Europa.
Eine wichtige Ursache hierfür: Bedingt durch den Klimawandel steigen die Wassertemperaturen, die Badesaison verlängert sich und es treten neue Erreger in Erscheinung. Daher sollten dermatologische Beschwerden im Zusammenhang mit Aufenthalt in Gewässern zunehmend auch dann differenziert betrachtet werden, wenn sie in bisher nicht endemischen Regionen auftreten [1].
Zerkarien-Dermatitis (Swimmer’s Itch)
Bei der Zerkarien-Dermatitis handelt es sich um eine immunologische Reaktion auf das Eindringen der Larvenstadien von Saugwürmern (Schistosomatidae), genannt Zerkarien, in die Haut des Menschen. Ursprünglich entstammen diese Parasiten aus Enten oder anderen Wasservögeln, ehe sie in stehenden, seichten und warmen Gewässern bevorzugt in Kontakt mit den Menschen treten. Hierbei sind erfahrungsgemäß Personen mit längeren Aufenthalten im Flachwasserbereich (z. B. beim Fischen) und Kinder (die sich bevorzugt in Ufernähe aufhalten) besonders betroffen.
Typischerweise manifestiert sich die Erkrankung wenige Stunden bis 3 Tage nach Exposition mit einem juckenden, papulösen Exanthem an unbedeckten Hautstellen – vor allem an den unteren Extremitäten. Die Erkrankung verläuft regelmäßig selbstlimitierend, die Symptome klingen innerhalb von 10 bis 20 Tagen ab [2].
Differenzialdiagnostisch abzugrenzen sind kutane Leishmaniose, frühe Skabies, Kontaktdermatitiden und verschiedene Insektenstiche. Ein direkter Nachweis der Zerkarien schlägt oftmals fehl, die Diagnostik beruht auf Anamnese und Klinik. Die Behandlung umfasst den Einsatz von oralen H1-Antihistaminika sowie topischen Kortikosteroiden. Doch es gibt auch verschiedene Möglichkeiten der Prophylaxe: Ein Einreiben mit Vaseline vor dem Baden erschwert das Eindringen des Erregers. Nach der Schwimmeinheit sollte intensiv geduscht und abgetrocknet werden. Auch Cremes mit z. B. Niclosamid können hilfreich für das Vermeiden einer Infektion sein [2]. In stark betroffenen Regionen ist ggf. ein aktives Gesundheitsmonitoring sinnvoll.
Katayama-Syndrom: Systemische Hypersensitivität
Das Katayama-Syndrom ist eine akute systemische Reaktion nach Erstkontakt mit Schistosomen – meist nach Aufenthalt in tropischen oder subtropischen Regionen. Etwa 2–8 Wochen nach Exposition ist mit dem Auftreten der Symptome zu rechnen. Charakteristisch sind hierbei Urtikaria, Fieber, respiratorische Symptome, Kopfschmerzen und gastrointestinale Beschwerden. Bei schweren Verläufen wurden Erscheinungen wie Lymphadenopathie und Hepatosplenomegalie beobachtet [3].
Eine wichtige Rolle kommt auch beim Katayama-Syndrom der Differenzialdiagnostik zu: Sie umfasst allergische Reaktionen, Arzneimittelexantheme und virale Infekte. Die Diagnostik der aquatisch erworbenen Dermatose erfolgt mit dem Nachweis von Eiern im Urin oder Stuhl und serologischen Verfahren. Therapeutisch steht Praziquantel mit 40 mg/kg KG zur Verfügung. Bei ausgeprägter Symptomatik kann eine adjuvante systemische Kortikosteroidgabe erwogen werden. Unbedingt empfehlenswert ist die Einbindung tropenmedizinischer Kolleginnen oder Kollegen. Tritt auch viele Wochen nach einer Fernreise eine unspezifische Urtikaria auf, sollte an eine Schistosomen-Infektion gedacht werden [3].
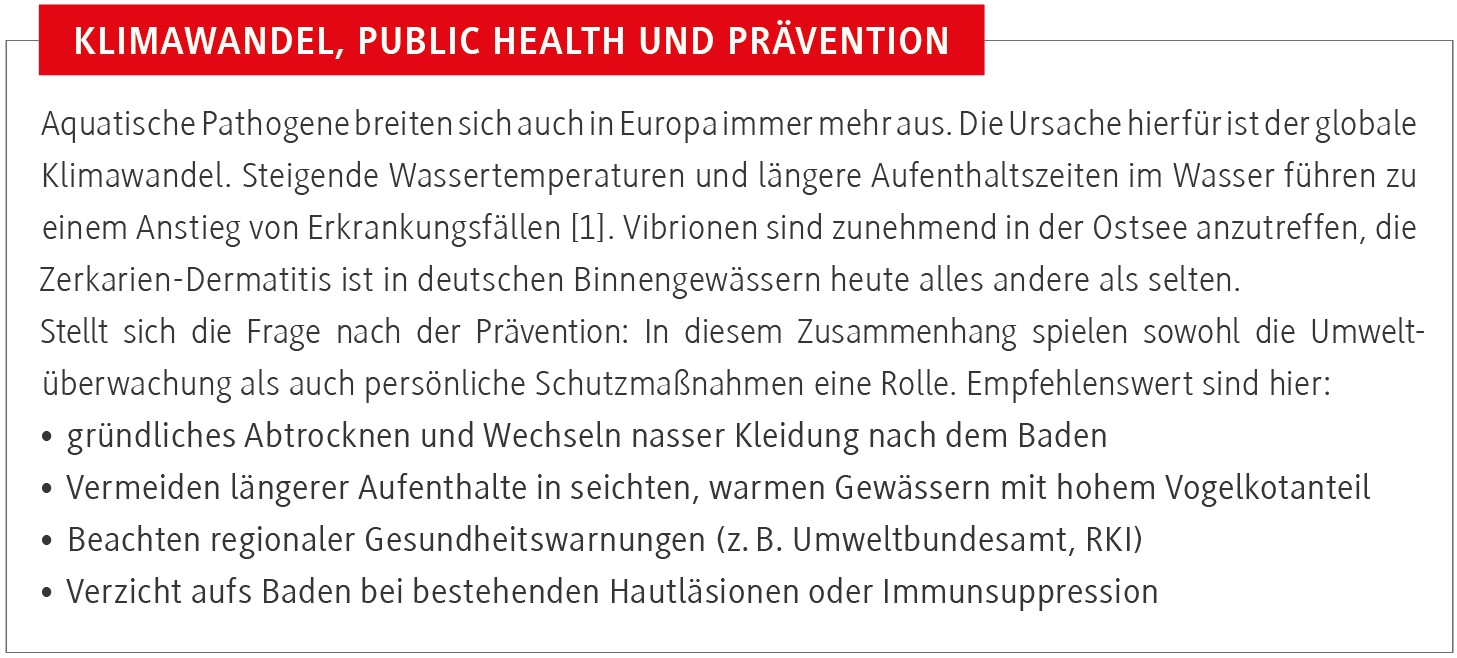
Späte kutane Schistosomiasis
Nach einer durchgemachten Infektion mit Schistosomen können auch Monate oder sogar Jahre später parasitenhaltige Knoten oder Papeln in Erscheinung treten – zumeist im Bereich der Genitalien, des Abdomens oder periumbilikal. Die Läsionen sind stark juckend, papulös bis warzenartig und entstehen im Zuge chronisch-granulomatöser Immunreaktionen auf eingeschlossene Schistosomen-Eier [4].
Serologische Verfahren, mikroskopische Urin- und Stuhluntersuchungen, PCR und Hautbiopsien stellen die diagnostischen Pfeiler der späten kutanen Schistosomiasis dar. Ausgeschlossen werden müssen ulzeröse Herpesinfektionen, Condylomata acuminata sowie Lichen planus. Therapeutisch gelten dieselben Prinzipien wie bei systemischer Schistosomiasis. Häufig erforderlich ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Tropenmedizin und Urologie. Essenziell ist zudem eine konsequente Nachsorge bei viszeralem Organbefall.
Meerbade-Dermatitis (Seabather’s Eruption)
Diese Form der aquatisch erworbenen Dermatitis wird durch Nesselkapseln (Nematocysten) kleiner Nesseltiere wie der Fingerhutqualle (Linuche unguiculata) oder Seeanemonen (Edwardsiella lineata) ausgelöst. Die Nematocysten gelangen beim Baden unter die Kleidung und werden später – meist beim Duschen mit Süßwasser oder durch Reibung – aktiviert. Infolgedessen tritt eine urtikarielle, juckende Dermatitis auf, streng begrenzt auf die von der Badebekleidung bedeckten Stellen [5].
Das Verbreitungsgebiet der Meerbade-Dermatitis umfasst vor allem die brasilianische Atlantikküste, die Karibik und zunehmend das östliche Mittelmeer. Rein symptomatisch verläuft die Behandlung – und zwar mit topischen Steroiden und oralen H1-Blockern. Badegäste sollten als Vorsichtsmaßnahme die nasse Badebekleidung sofort ausziehen und sich gründlich duschen. Reisende in Endemiegebiete sollten vorab gezielt beraten werden [5].
Vibrio vulnificus: Infektion durch Salzwasser
Bei Vibrio vulnificus handelt es sich um ein halophiles, gramnegatives Bakterium, das insbesondere in salzhaltigen, warmen Küstengewässern vorkommt. Mit steigenden Wassertemperaturen nimmt die Prävalenz auch in Europa zu – besonders an der Ostsee [6,7]. Kleine Wunden beim Baden fungieren als Eintrittspforte für das Bakterium. Ein erhöhtes Risiko besteht insbesondere für Menschen mit chronischer Lebererkrankung, Diabetes oder Immunsuppression.
Klinische Anzeichen sind Schmerzen, Erytheme und bullöse Läsionen bis zur nekrotisierenden Fasziitis. Mögliche Begleiterscheinungen sind Fieber und Sepsis bis hin zum Kreislaufversagen. Zu beachten ist, dass die Mortalität im Zuge einer Sepsis bei bis zu 30 % liegt. Die Behandlung umfasst die sofortige stationäre Aufnahme und Gabe eines Cephalosporins der 3. Generation in Kombination mit Doxycyclin. Relativ häufig ist eine chirurgische Intervention nötig. In Deutschland ist eine Infektion mit Vibrio vulnificus meldepflichtig. Eine große präventive Bedeutung haben in diesem Zusammenhang regionale Warnsysteme, wie sie vom Robert Koch-Institut koordiniert werden [7].
Verletzungen durch Meerestiere
Neben infektiösen oder immunologischen Dermatosen spielen auch mechanische und toxische Hautverletzungen durch Meerestiere eine Rolle. Hier sind insbesondere zu nennen:
Die Erstversorgung erfolgt durch Spülen mit Salzwasser (nicht Süßwasser!), ggf. Fremdkörperentfernung, Schmerztherapie und Wärmeanwendung (40–45 °C), um thermolabile Toxine zu deaktivieren. Sollten Infektionszeichen vorliegen, sollten Antibiotika mit Wirkstoffen gegen gramnegative Erreger appliziert werden. Gerade in südlichen Urlaubsregionen sollten auch exotische Meerestiere (z. B. Feuerfische) in die Risikoabwägung einbezogen werden.

Aquatisch erworbene Dermatosen sind differenzialdiagnostisch bedeutsam – insbesondere bei papulösen oder urtikariellen Effloreszenzen nach Wasserkontakt. Eine große Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Anamnese zu, die Aufenthaltsort, Reiseverhalten, Expositionsdauer und mögliche Begleitsymptome umfasst. Doch auch ohne Fernreise können heutzutage beispielsweise eine Vibriose oder Zerkarien-Dermatitis auftreten.
Eine konsequente Aufklärung von Risikogruppen, inklusive Reisenden, Kindern und chronisch Kranken ist entscheidend. Dermatologen und Dermatologinnen sollten aquatische Pathogene im Blick behalten – denn auch juckende Papeln nach dem Bad können der Beginn einer systemischen Infektion sein.

Vortrag „Hot Topic – Reisedermatologie” von Prof. Peter Schmid-Grendelmeier, Derma Update 2024