

Aromatherapie ist ein Teilgebiet der Phytotherapie und nutzt die pharmakologisch wirksamen Bestandteile ätherischer Öle. In der gynäkologischen Praxis erobert sich die Aromatherapie ihren Platz zur dauerhaften Verbesserung der Vaginalgesundheit.
Ätherische Öle sind hochkonzentrierte Substanzen, die von Pflanzen als sekundäre Pflanzenstoffe gebildet werden und dort unter anderem dem Schutz vor Bakterien, Pilzen, Viren oder Fraßfeinden dienen. Auch in der Humanmedizin können ätherische Öle aufgrund ihrer antimikrobiellen, antiviralen, entzündungshemmenden, krampflösenden und immunmodulierenden Eigenschaften sinnvoll eingesetzt werden.
Seit Jahrhunderten werden sie in der Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden (z. B. mit Pfefferminz-, Kümmel-, Anis- und Kamillenöl), bei Infektionen der Atemwege (z. B. Thymian-, Eukalyptusöl) sowie zur Beruhigung und Schlafförderung (z. B. Lavendelöl) angewendet. Moderne Forschung bestätigt zunehmend diese traditionellen Anwendungen und erschließt neue Einsatzfelder in der integrativen Medizin. In der gynäkologischen Praxis erobert sich die Aromatherapie ihren Platz zur dauerhaften Verbesserung der Scheidengesundheit.
Für die intravaginale Anwendung sind ausschließlich naturreine, pestizidfreie ätherische Öle geeignet. „Naturidentische“ Produkte aus dem Labor sind chemisch vereinfacht und enthalten nicht das komplexe Zusammenspiel von Inhaltsstoffen und das natürliche Vollprofil, das für die Wirksamkeit und das Multi-Target-Prinzip verantwortlich ist.
Wirksamkeit gegenüber vaginalpathogenen Keimen
In der Aromatherapie liegen inzwischen umfangreiche Erfahrungen mit der gezielten Anwendung ätherischer Öle bei vaginalpathogenen Keimen vor. Aromatogramme zeigen, dass sich je nach Erreger bestimmte Öle wiederholt als besonders wirksam erweisen.
Bei Candida albicans konnten unter anderem Neroli, Teebaum, Lemongrass, Rosengeranie, Palmarosa, Manuka, Niaouli, Rosmarin Verbenon und Lavendel fein eine deutliche antimykotische Wirkung entfalten. Für Candida glabrata, eine häufig therapieresistente Spezies, bewährten sich insbesondere Neroli, verschiedene Thymian-Chemotypen (Thymol, Linalool, „kopfig“), Palmarosa, Lavendel fein, Manuka, Rosengeranie, Teebaum und Muskatellersalbei.
Bei Enterococcus faecalis zeigten sich Manuka, Neroli, Teebaum, Rosengeranie, Palmarosa, Lemongrass, Lavendel fein, Thymian (CT Thymol), Niaouli und Zistrose als vielversprechend. Die häufig in der Schwangerschaft relevanten β-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe B reagierten besonders auf Rosengeranie, Lemongrass, Teebaum, Palmarosa, Manuka, Niaouli, Neroli und Rosenöl (Rose damascena).
Auch bei Staphylococcus aureus ließ sich eine gute Wirksamkeit nachweisen, vor allem durch Neroli, Manuka, Lavendel fein, Teebaum, Thymian (CT Linalool), Ravintsara, Thymian „kopfig“, Rosengeranie, Cajeput und Koriander. Schließlich konnten bei Streptococcus agalactiae ätherische Öle wie Neroli, Manuka, Lavendel fein, Rosengeranie, Lemongrass, Muskatellersalbei, Teebaum, Palmarosa, Thymian (CT Thymol, CT Linalool) sowie Niaouli positive Effekte zeigen.
Auf Grundlage dieser Erkenntnisse können auch ohne Aromatogramm Basis-Rezepturen entwickelt werden, die die bekannten Kompetenzen der jeweiligen Öle gezielt nutzen. Dennoch zeigt die Praxis, dass gerade bei therapieresistenten Keimen ein Aromatogramm von großem Nutzen ist: Es erlaubt die maßgeschneiderte Zusammenstellung individueller Rezepturen, die wie ein „Maßanzug“ exakt auf das Keimspektrum und die Situation der Patientinnen zugeschnitten sind.
Aromatogramme für individuelle Therapie
Das Aromatogramm ermöglicht eine gezielte Auswahl der wirksamsten Öle. Hierbei wird ein Abstrich aus der Vaginalschleimhaut mikrobiologisch untersucht und die Empfindlichkeit der Keime gegenüber verschiedenen Ölen getestet. So lassen sich auch Erreger erreichen, die unter Biofilmen verborgen sind und durch Antibiotika kaum erfasst werden.
Die Ergebnisse von Aromatogrammen zeigen, welche ätherischen Öle die stärkste hemmende Wirkung auf bestimmte Keime haben. In der therapeutischen Praxis ist es jedoch sinnvoll, neben diesen „Leitölen“ auch solche auszuwählen, die einen zusätzlichen Nutzen für die Patientin mitbringen.
Auf Basis eines Aromatogramms lassen sich gezielt individuelle Rezepturen entwickeln, die den jeweiligen Keimen angepasst sind. Dies ermöglicht eine maßgeschneiderte Therapie mit hoher Wirksamkeit. Eingesetzt werden können dabei verschiedene Darreichungsformen:
Gerade bei rezidivierenden Infekten ist häufig an einen „Ping-Pong-Effekt“ zu denken, bei dem sich Partner gegenseitig immer wieder anstecken. In diesen Fällen ist es sinnvoll, beide zu behandeln – auch mithilfe spezieller Partneröle. Auf diese Weise kann die Rezeptur nicht nur antimikrobiell wirken, sondern zugleich Symptome lindern und die Heilung fördern. Beispiele hierfür sind:
Viele ätherische Öle haben also nicht nur eine gezielte Wirkung gegen Bakterien, Viren oder Pilze, sondern auch begleitende Effekte, die in einer ganzheitlichen Behandlung wertvoll genutzt werden können.
Die ätherischen Öle können mit pflanzlichen Auszügen, wie Frauenmantel (Alchemilla), der die Schleimhaut stärkt, und Sanddornfruchtfleischöl, das reich an Carotinoiden und Vitamin E ist, kombiniert werden.
Risiken, Vorsichtsmaßnahmen und Lagerung
Ätherische Öle sind hochkonzentrierte, empfindliche Naturstoffe. Ihre Qualität und Wirksamkeit hängen maßgeblich von der richtigen Lagerung ab. Werden sie unsachgemäß aufbewahrt, können sie oxidieren oder zerfallen, wodurch ihre therapeutische Wirkung nachlässt und sogar reizende Abbauprodukte entstehen können.
Ätherische Öle müssen korrekt dosiert und gelagert werden. Eine fehlerhafte Anwendung (unverdünnt, überdosiert, alt oder von minderer Qualität) kann zu Brennen, Reizungen und Schleimhautschädigung führen. Besondere Vorsicht gilt in der Frühschwangerschaft und bei bestimmten Inhaltsstoffen (z. B. Menthol, Campher). Wichtige Grundsätze der Lagerung sind:
Für sehr empfindliche Öle empfiehlt es sich, nach Anbruch die Restmenge in kleinere, sterile Fläschchen umzufüllen, um den Sauerstoffkontakt zu minimieren. Ein Kühlschrankfach speziell für ätherische Öle ist ideal, da die konstante Temperatur die Haltbarkeit deutlich verlängert.
Ein besonderes Augenmerk gilt dem Teebaumöl: Es ist eines der am häufigsten eingesetzten Öle bei vaginalpathogenen Keimen und wirkt stark antibakteriell, antiviral und antimykotisch. Gleichzeitig ist Teebaumöl jedoch sehr empfindlich gegenüber Sauerstoff. Bei unsachgemäßer Lagerung kommt es zur Bildung von Peroxiden, die haut- und schleimhautreizend wirken können.
Daher ist auf höchste Qualität und eine korrekte Aufbewahrung zu achten: kühl, lichtgeschützt, gut verschlossen und möglichst ohne Sauerstoffkontakt. Manche Hautreaktion ist nicht auf das ätherische Öl an sich zurückzuführen, sondern auf die Abbauprodukte, die bei der Lagerung entstanden sind.
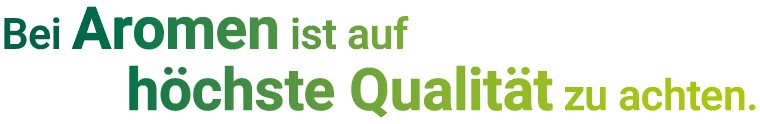
Nachhaltigkeit statt Kurzzeit-Effekt
Die Behandlung mit ätherischen Ölen unterscheidet sich deutlich von einer klassischen 3-Tages-Kur mit Clotrimazol. Sie erfordert mehr Geduld und Ausdauer, bietet jedoch oft einen deutlich dauerhafteren Erfolg. Vom Abstrich über die Erstellung des Aromatogramms bis hin zur individuellen Rezeptur können mehrere Tage vergehen. Anschließend ist häufig eine längere Behandlungsdauer notwendig, die unter Umständen in Form von einer Schaukeltherapie (wechselnde Kombinationen verschiedener Öle und Pflanzenextrakte) durchgeführt wird.
Ziel der Therapie ist nicht nur die Eliminierung der Erreger, sondern vor allem die Stabilisierung der vaginalen Flora. Dazu gehört:
Erst durch diese Kombination wird ein langfristiger Erfolg erreicht und erneuten Infektionen vorgebeugt.
Eine vaginale Dysbiose schwächt die Schutzfunktion der Schleimhaut und begünstigt Virusinfektionen sowie zelluläre Veränderungen. Nach einem auffälligen PAP-Test steht die gynäkologische Abklärung im Vordergrund. Naturheilkundliche Maßnahmen – etwa individuell zusammengesetzte Zäpfchen mit ätherischen Ölen, Vitamin D und pflanzlichen Wirkstoffen – können begleitend eingesetzt werden, um die Vaginalflora zu stabilisieren, das Immunsystem zu stärken und Heilungsprozesse zu fördern.
Aromatherapie ist Teil einer umfassenden integrativen Medizin, die Phytotherapie, orthomolekulare Therapie, Darmgesundheit und die Behandlung stiller Entzündungen (Silent Inflammation) einbezieht. Damit lassen sich sowohl akute als auch chronisch-rezidivierende gynäkologische Beschwerden auf einer breiteren Basis angehen.
Die Autorin

Prof. Dr. med. Ingrid Gerhard
Albert-Überle-Straße 11
69120 Heidelberg
Literatur bei den Autorinnen