
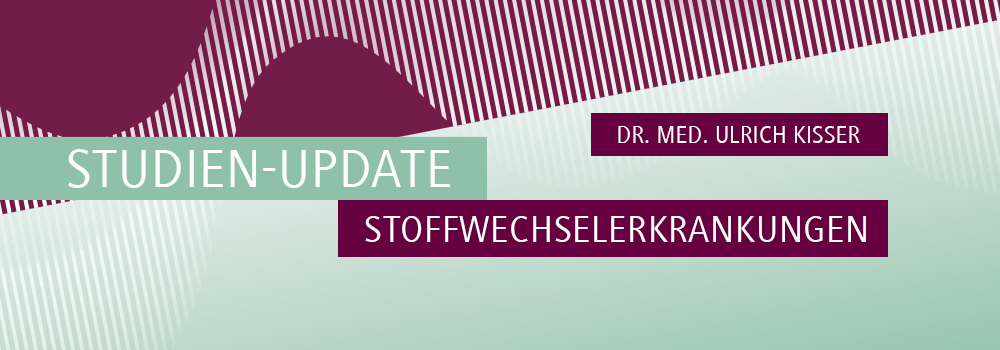
Romosozumab verbessert die Mikroarchitektur des Knochens +++ Wirksames Therapeutikum gegen nicht alkoholische Fettleber +++ Kurzfristige intensive Insulintherapie bei Typ-2-Diabetes +++ ischämischer Schlaganfall +++ Nierenfunktion zur Prognose
Romosozumab verbessert die Mikroarchitektur des Knochens
In einer Post-hoc-Analyse der ARCH-Studie wurde untersucht, wie sich Romosozumab auf die Knochenmikroarchitektur bei postmenopausalen Frauen mit Osteoporose auswirkt. Dabei wurde der trabekuläre Knochen-Score (TBS) als Maß für die Knochenqualität verwendet. Es zeigte sich, dass eine 12-monatige Behandlung mit Romosozumab gefolgt von einer 24-monatigen Gabe von Alendronat zu einem signifikant geringeren Frakturrisiko und zu einem signifikant besseren TBS-Wert führte als eine alleinige 36-monatige Alendronat-Therapie. Diese Unterschiede blieben auch nach 24 und 36 Monaten bestehen. Zudem erhöhte sich der Anteil der Patientinnen mit „normalem“ TBS in der Romosozumab-Gruppe von 28,9 % zu Studienbeginn auf 48,1 % nach 12 Monaten. Die Veränderungen im TBS korrelierten nur schwach mit den Veränderungen der Knochendichte (BMD), was darauf hindeutet, dass TBS zusätzliche Informationen über die Knochenqualität liefert, die durch BMD allein nicht erfasst werden.
Fazit: Diese Ergebnisse unterstützen den Einsatz von Romosozumab zur Verbesserung der Knochenmikroarchitektur bei postmenopausalen Frauen mit Osteoporose.
McClung MR et al., Journal of Bone and Mineral Research 2025; 40: 193–200
Wirksames Therapeutikum gegen nicht alkoholische Fettleber
Eine Studie untersuchte die Wirksamkeit von Pemvidutid, einem dualen Glucagon-like-Peptide-1-/Glukagon-Rezeptoragonisten, bei Personen mit metabolisch assoziierter Steatose der Leber (MASL): 94 adipöse Menschen mit einem Leberfettgehalt (LFC) von ≥ 10 % wurden über 12 Wochen einmal wöchentlich subkutan mit Pemvidutid in Dosen von 1,2 mg, 1,8 mg oder 2,4 mg oder mit Placebo behandelt. Nach 12 Wochen zeigte die 1,8-mg-Dosis die stärkste Wirkung: Der LFC wurde um 68,5 % reduziert. Insgesamt 94,4 % der Betroffenen erreichten eine Reduktion des LFC um ≥ 30 % und 55,6 % eine Normalisierung. Zusätzlich kam es zu signifikanten Verbesserungen bei Leberentzündungsmarkern und einem mittleren Gewichtsverlust von 4,3 %. Schwerwiegende Sicherheitsbedenken wurden nicht berichtet.
Fazit: Pemvidutid könnte also eine vielversprechende Behandlungsoption für MASL und Fettleibigkeit darstellen.
Harrison SA et al., Journal of Hepatology 2025; 82: 7–17
Kurzfristige intensive Insulintherapie bei Typ-2-Diabetes
In einer randomisierten Studie untersuchten Diabetologen und Diabetologinnen die Wirksamkeit einer kurzfristigen intensiven Insulintherapie mittels kontinuierlicher subkutaner Insulininfusion (CSII) in Kombination mit einer kohlenhydratarmen Ernährung (LCD) bei neu diagnostizierten Typ-2-Diabetes-Patienten und -Patientinnen. Die Teilnehmenden wurden in 2 Gruppen eingeteilt: eine Gruppe mit konventioneller CSII und herkömmlicher Lebensstilberatung sowie eine Gruppe mit intensiver CSII und LCD. Primäres Ziel war die Entwicklung der HbA1c-Werte; sekundäre Ziele umfassten unter anderem Körpergewicht, Body-Mass-Index (BMI) und glykämische Kontrolle. Die Auswertung ergab, dass die Personen mit intensiver Therapie länger im Zielbereich (TIR) waren und signifikant bessere Remissionsraten erreichten als die Teilnehmenden der Vergleichsgruppe. Zusätzlich verzeichnete sie signifikante Verbesserungen folgender Werte: Nüchternplasmaglucose, HbA1c, Insulinresistenz (HOMA-Index), Triglyceride (TG), LDL-Cholesterin, BMI, viszerales und subkutanes Fett. Diese Parameter korrelierten signifikant mit den HbA1c-Werten.
Fazit: Das Autorenteam kommt zu dem Schluss, dass die Kombination aus intensiver CSII und LCD die Remissionsrate bei neu diagnostizierten Typ-2-Diabetes-Patienten und -Patientinnen verbessert.
Huang X et al., J Diabetes Investig 2025; 16: 426–33
Ischämischer Schlaganfall
In einer Post-hoc-Analyse der RICAMIS-Studie wurde der Einfluss des metabolischen Syndroms (MetS) auf die Wirksamkeit der fernen ischämischen Postkonditionierung (RIPostC) bei Personen mit akutem moderatem ischämischem Schlaganfall ohne Reperfusionsbehandlung untersucht.
Von 1 482 Patientinnen und Patienten erfüllten 602 die Kriterien für MetS. Nach 90 Tagen erreichten 68,8 % der MetS-Erkrankten in der RIPostC-Gruppe ein exzellentes funktionelles Ergebnis im Vergleich zu 56,1 % in der Kontrollgruppe (Odds Ratio [OR] 1,751; 95%-Konfidenzintervall [KI] 1,248–2,456; p = 0,001). Bei den Patienten und Patientinnen ohne MetS zeigte sich kein signifikanter Unterschied (66,6 % vs. 64,6 %; OR 1,103; 95%-KI 0,833–1,461; p = 0,5). Es bestand ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen MetS-Status und RIPostC-Behandlung (p = 0,04).
Fazit: Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass RIPostC insbesondere bei Schlaganfallpatientinnen und -patienten mit MetS wirksam sein könnte. Weitere Studien seien jedoch erforderlich.
Zhang YN et al., J Am Heart Assoc 2025; 14: e037859
Nierenfunktion zur Prognose
Die Multicenter-Studie REAL-CAD untersuchte den Einfluss einer chronischen Nierenerkrankung (CNE) und einer sich verschlechternden Nierenfunktion (VNF) auf die Prognose von Personen mit chronischem Koronarsyndrom (CKS). Dabei zeigte sich, dass eine bestehende CNE (eGFR < 60 ml/min/1,73 m²) sowie eine Abnahme der Nierenfunktion um (≥ 20 % im ersten Jahr) signifikant mit einem erhöhten Risiko für schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse verbunden sind. Auch eine moderate Verschlechterung der Nierenfunktion bei Personen ohne CNE ging mit einem erhöhten Risiko einher.
Fazit: Die Studie unterstreicht die Bedeutung einer regelmäßigen Überwachung der Nierenfunktion bei CKS-Patienten und -Patientinnen, unabhängig vom Vorliegen einer CNE, und legt nahe, dass selbst leichte Verschlechterungen prognostisch relevant sein können. Eine frühzeitige nephro- und kardioprotektive Therapie ist entscheidend zur Risikominimierung.
Yoshiki Y et al., J Am Heart Assoc 2025; 14: e034627
Bildnachweis: Jobalou (iStockphoto)