

Schätzungsweise jeder dritte Erwachsene in Deutschland erwirbt im Laufe seines Lebens eine Schilddrüsenerkrankung. Dann können naturheilkundliche Maßnahmen wie die orthomolekulare Medizin oder Phytotherapie therapiebegleitend Symptome lindern und die Lebensqualität verbessern.
Mit zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit für Schilddrüsenerkrankungen, bei denen die Bildung der Schilddrüsenhormone Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3) erhöht (Hyperthyreose) oder reduziert (Hypothyreose) sein kann. Bei einer Hyperthyreose sind eine Schilddrüsenautonomie und die Autoimmunerkrankung Morbus Basedow, die oft mit einer endokrinen Orbitopathie einhergeht, die häufigsten Ursachen [1]. Auch bei der Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis können zu Beginn der Erkrankung die Werte für die Schilddrüsenhormone erhöht sein. Im Verlauf wird das Schilddrüsengewebe zunehmend zerstört und es tritt eine dauerhafte Unterfunktion auf. Die Hashimoto-Thyreoiditis ist die häufigste Ursache einer Hypothyreose, deren Prävalenz in Europa bei etwa 3 % liegt. Frauen sind etwa fünfmal häufiger betroffen als Männer [2,3].
Ernährungstherapie
Zur Vorbeugung und Begleitung autoimmuner Schilddrüsenerkrankungen sollte eine entzündungshemmende Ernährung empfohlen werden. Durch den ausreichenden Konsum von Omega-3-Fettsäuren, Pflanzeninhaltsstoffen sowie Vitaminen und Mineralstoffen (z. B. Zink und Selen) kann der Entzündungsstatus verringert werden [4]. Vor allem bei Hashimoto-Thyreoiditis hat sich die mediterrane Ernährung bewährt [5]. Aufgrund des recht hohen Gehalts an Arachidonsäure, die proinflammatorische Effekte zeigt, sollten Schweinefleisch und Wurstwaren gemieden werden. Da insbesondere fettreicher Kaltwasserfisch entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren und Jod enthält, können bei Hashimoto-Thyreoiditis 2 Portionen pro Woche empfohlen werden. Auch Kelp-Algen sind eine gute Jodquelle [6].
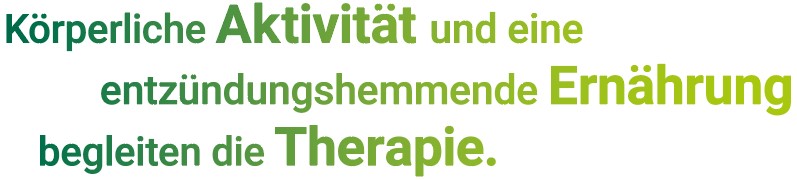
Orthomolekulare Medizin
Als auslösende Faktoren der Hashimoto-Thyreoiditis werden u. a. ein Selen- und/oder Vitamin-D-Mangel diskutiert. Labordiagnostisch unterstützt, kann die Supplementierung von antiinflammatorischen und schilddrüsenprotektiven Mikronährstoffen wie Selen, Eisen, Vitamin B12 und D das Risiko einer Hashimoto-Thyreoiditis verringern oder ihren Verlauf mildern. Zudem kann die zielgerichtete Supplementierung die medikamentöse Therapie optimieren und die Lebensqualität der Betroffenen deutlich verbessern [2].
In der orthomolekularen Therapiebegleitung hat Selen einen besonderen Stellenwert, denn die Schilddrüse ist das Organ mit dem höchsten Selengehalt und daher empfindlich gegenüber einer unzureichenden Selenversorgung. So ist die Dejodase, die inaktives T4 in aktives T3 umwandelt, selenabhängig. Auch schützen selenabhängige Enzyme wie die Glutathion-Peroxidase und die Thioredoxin-Reduktase das Schilddrüsengewebe vor oxidativen Schäden und Entzündungsprozessen. Daher sollten Defizite adäquat mit Natriumselenit korrigiert werden. Das Ziel sollte stets ein Plasmawert zwischen 130 und 155 µg/l sein [2].
Neben Selen ist auch Eisen essenziell für die Bildung von Schilddrüsenhormonen. So katalysiert das eisenabhängige Enzym Thyreoperoxidase (TPO) wesentliche Schritte der Hormonbildung. Bereits eine leichte Eisenunterversorgung kann die TPO-Aktivität beeinträchtigen und damit die Entstehung von Schilddrüsenerkrankungen begünstigen. Je stärker die Unterversorgung mit Eisen ist, desto ausgeprägter sind die negativen Effekte auf die Schilddrüse. Liegt bei Hashimoto-Thyreoiditis gleichzeitig ein Jodmangel vor, verstärkt sich der Einfluss einer Eisenunterversorgung auf die Schilddrüse. Daher sollte der Eisenhaushalt über Bestimmung des löslichen Transferrin-Rezeptors oder des Ferritin-Werts abgeklärt werden [2].
Vitamin B12 und D
Menschen mit Hashimoto-Thyreoiditis weisen oft gleichzeitig eine Typ-A-Gastritis auf. Bei dieser autoimmunen Magen-Darm-Erkrankung werden Antikörper gegen die Belegzellen des Körpers gebildet, die u. a. den Intrinsic-Faktor bilden, der für die Aufnahme von Vitamin B12 aus der Nahrung notwendig ist. Bei einer Typ-A-Gastritis kann sich daher ein Mangel an Vitamin B12 entwickeln. Unternormale Spiegel können durch orale hoch dosierte Supplemente (z. B. 1 000 µg pro Tag) oder durch intramuskuläre Gaben korrigiert werden [2].
Auch sollte der Vitamin-D-Status geprüft werden, denn Menschen mit autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen zeigen im Vergleich zu Gesunden signifikant niedrigere 25(OH)D-Spiegel. Die Ausprägung des Vitamin-D-Mangels korreliert mit dem Anstieg der Autoantikörper (beispielsweise gegen TPO) sowie mit dem Krankheitsverlauf. Bei Hashimoto-Thyreoiditis kann die Supplementierung von 1 200 bis 1 400 IE Vitamin D pro Tag über 4 Monate zu einer deutlichen Senkung der TPO-Antikörper-Spiegel führen – als Zeichen einer reduzierten Krankheitsaktivität [2].
Schilddrüsenmikronährstoff Jod
Bei einer Hyperthyreose sind Jod-Supplemente kontraindiziert, wohingegen bei einer Hypothyreose der Bedarf an Jod erhöht ist. In Deutschland sind jedoch viele Menschen aufgrund ihrer Ernährung nur unzureichend mit dem essenziellen Spurenelement versorgt, denn wichtige Jodquellen sind Seefisch und Milch.
Auch ein hoher Kaffee- oder Teekonsum kann den Jodbedarf steigern. Daher ist Personen mit einer Schilddrüsenunterfunktion die Verwendung von jodiertem Speisesalz anzuraten und bei einem labortechnisch nachgewiesenen Defizit ist es empfehlenswert, adäquat zu supplementieren [7].
Darüber hinaus können Schüßler-Salze bei Schilddrüsenfunktionsstörungen unterstützend wirksam sein. Aufgrund der regulierenden Wirkung können sowohl bei Hyper- als auch bei Hypothyreose Nr. 15 Kalium jodatum D6 und Nr. 24 Arsenum jodatum D6 abwechselnd eingenommen werden [8].
Phytotherapie
Bei Hyperthyreose werden in der ayurvedischen Medizin das Gewürz Asafoetida (Asant) sowie Zubereitungen aus der Wurzel der Schlafbeere (Ashwagandha) eingesetzt. Bei Hypothyreose werden die Gewürze Ingwer und schwarzer Pfeffer empfohlen [8]. Die Anwendung von 500 mg Ingwer täglich zusätzlich zu L-Thyroxin kann bei Hypothyreose subjektive Beschwerden wie Gewichtszunahme, Kältegefühl, Obstipation, trockene Haut, Appetit, Gedächtnisprobleme, Konzentrationsstörungen und Schwindel(-gefühl), lindern und positive Effekte auf Stoffwechselparameter und das Körpergewicht zeigen [9].
Generell kann die Phytotherapie zur symptomatischen Behandlung leichter Schilddrüsenfunktionsstörungen eingesetzt werden. Für die Therapiebegleitung leichter Hyperthyreosen mit vegetativ-nervöser, insbesondere kardialer Symptomatik, eignen sich Wolfstrapp- (Lycopi herba) und Herzgespannkraut. Wolfstrapp kann vor allem bei jüngeren Patienten und Patientinnen zur Überbrückung der Wartezeit bis zur Operation oder Radiojodtherapie angewendet werden. Das Kraut ist auch zur naturheilkundlichen Begleitung bei prälatenter Hyperthyreose geeignet, denn es zeigt antigonadotrope und antithyreotrope Wirkung, hemmt die TSH-vermittelte Schilddrüsenstimulation, den Jodtransport in die Schilddrüse sowie die extrathyreoidale Dejodierung von T4. Es sind Tees oder Monopräparate mit standardisierten Wolfstrapp-Extrakten verfügbar. Bei thyreogen bedingten kardialen Symptomen kann Herzgespannkraut adjuvant eingesetzt werden. Die Heilpflanze wirkt leicht negativ chromotrop, antiarrhythmisch, sedativ und schwach blutdrucksenkend. Zudem lindert sie Herzrasen und Herzklopfen. Herzgespannkraut kann in Form von Tees oder Extrakten angewendet werden. Auch eignen sich Kombinationspräparate mit sedativ wirksamen Heilpflanzen wie Weißdorn, Melisse oder Baldrian.
Zur Konstitutionsstärkung von Patientinnen und Patienten mit einer Schilddrüsenunterfunktion können therapiebegleitend Adaptogene wie Ginseng, Astragalus, Rosenwurz oder Taigawurzel nützlich sein. Um Wassereinlagerungen bei Hypothyreose zu lindern, können Zubereitungen aus Brennnessel angewendet werden [8].
Weitere naturheilkundliche Verfahren
Heiße Anwendungen können die Symptomatik bei Hyperthyreose verschlimmern, daher sollten Anwendungen mit lokaler Kälteeinwirkung bevorzugt werden. So können Heilerde-Halswickel (Lehmwickel) bis zur Erwärmung angewendet und sollten mehrmals gewechselt werden. Auch dreimal tägliche Rumpfwickel zum Wärmeentzug haben sich bewährt. Kühle Oberkörperwaschungen und Wassertreten können ebenfalls bei einer Schilddrüsenüberfunktion Linderung verschaffen. Abends sind Baldrianbäder (36 bis 38 °C) sowie Wadenwickel hilfreich. Kuren mit milden Sole- und Schwefelbädern können empfohlen werden. Jodhaltige Seebäder hingegen sind bei Hyperthyreose kontraindiziert. Mit Entspannungsgymnastik, Muskellockerung oder Wanden kann zusätzlich naturheilkundlich unterstützt werden.
Bei Hypothyreose wirken kräftige Reize günstig. Es können Kneipp-Güsse (Knie-Vollguss), wechselwarme Waschungen, Wassertreten, ansteigende Fuß- und Armbäder sowie Voll- und Bürstenbäder empfohlen werden. Da Menschen mit Hypothyreose zum Frieren neigen, können Bäder mit anregenden Badezusätzen wie Rosmarin Linderung verschaffen. Kuren in Seebädern und jodhaltige Solebäder haben sich bei Schilddrüsenunterfunktion ebenfalls bewährt. Weiterhin sind Gymnastik, Wandern und Walking zur Stoffwechselanregung geeignet [8].


Robert Schmidt
Ärztlicher Direktor
Krankenhaus für Naturheilweisen
81545 München
www.krankenhaus-naturheilweisen.de
Naturheilkundliche Behandlungsoptionen
Ein Jodmangel kann zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen. Erwachsenen ist die tägliche Aufnahme von rund 180 µg Jod pro Tag zu empfehlen. Fettreiche Meeresfische sind reich an Jod, pflanzliche Jodquellen sind Meeresalgen, auch jodiertes Speisesalz oder die Einnahme von Jodtabletten können in Betracht gezogen werden. Mit der empfohlenen Aufnahme von 5 g Kochsalz pro Tag können mit jodiertem Speisesalz etwa 100 µg Jodid aufgenommen werden. Eine Nahrungsergänzung um 100 µg Jod pro Tag wäre also für die meisten Erwachsenen in Deutschland (jodarme Böden) durchaus sinnvoll. Ein Eisenmangel kann die Effizienz der Jodsubstitution beeinträchtigen und sollte dann ebenfalls substituiert werden. Selen unterstützt die normale Schilddrüsenfunktion und wirkt antioxidativ. Ein Mangel kann das Auftreten einer Hashimoto-Thyreoiditis begünstigen. Die tägliche Aufnahme sollte bei 100 bis 200 µg liegen, bei manifester Hashimoto-Thyreoiditis bei 200 bis 300 µg. Idealerweise erfolgt die Substitution laborgestützt mit Spiegel im oberen Normbereich. Zink ist ebenfalls an der Hormonproduktion in der Schilddrüse beteiligt, auch Vitamin D und B-Vitamine sind für den Energiestoffwechsel elementar. Phytotherapeutisch kann symptomatisch mit vitalisierenden, regenerativen Präparaten, beispielsweise Ginseng oder Rosenwurz, unterstützt werden.
Auch bei Funktionsstörungen der Schilddrüse, die mit einer Überfunktion einhergehen, ist es hilfreich, den Jod-, Selen-, Zink-, Vitamin-D- und B-Vitaminhaushalt laborchemisch zu bestimmen und auszugleichen. Antioxidantien wie Vitamin C und E helfen, oxidativen Stress zu reduzieren, der eine Überfunktion begünstigen kann. Magnesium unterstützt die Herzfunktion, die bei Hyperthyreose zu schnellem Puls und Extraschlägen neigen kann. Herzgespannkraut als Tee oder in Kapselform kann phytotherapeutisch ebenfalls den Herzrhythmus stabilisieren. Wolfstrappkraut (als Tee oder Fertigarzneimittel) reduziert direkt die übermäßige Bildung von aktiven Schilddrüsenhormonen. Innerhalb von 2 Wochen ist eine spürbare Besserung der Symptome zu erwarten. Ein konventionelles Thyreostatikum kann aber i. d. R. nicht ersetzt werden.

Sowohl bei einer Über- als auch bei einer Unterfunktion der Schilddrüse können naturheilkundliche Maßnahmen aus der Ernährungs-, Mikronährstoff-, Phyto-, Hydro- sowie die Bewegungstherapie zur Symptomlinderung beitragen. Um Defizite adäquat ausgleichen zu können, sollten bei Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen regelmäßig der 25(OH)D- und Vitamin-B12-Status sowie der Eisen- und Selenhaushalt kontrolliert werden. Da Omega-3-Fettsäuren eine wichtige Rolle bei der Entzündungshemmung innehaben, sollte auch der Omega-3-Index bestimmt werden [2]. Generell ist eine gesunde Lebensweise mit ausreichend körperlicher Aktivität und einer entzündungshemmenden Ernährung zur Prävention und Therapiebegleitung von Schilddrüsenerkrankungen ratsam.
Bildnachweis: privat